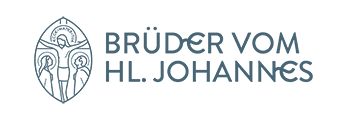Schwer punkte —
Gebet
Schwerpunkte —
- Der Hl. Johannes
- Der Geist der Gemeinschaft
- Die Ordensgelübde
- Die drei Bünde
- Drei Arten der Weisheit
- Das Gebet

Der Hl. Johannes
 Als Jesus seine Mutter unter dem Kreuz stehen sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: „Frau, siehe, dein Sohn!“ Dann sagte er zu dem Jünger: „Siehe, deine Mutter!“ Von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. (vgl. ]oh 19, 25 27)
Als Jesus seine Mutter unter dem Kreuz stehen sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: „Frau, siehe, dein Sohn!“ Dann sagte er zu dem Jünger: „Siehe, deine Mutter!“ Von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. (vgl. ]oh 19, 25 27)
Johannes ist der geliebte Jünger, der Zeuge des geöffneten Herzens Jesu und der beschauliche Theologe. Als geliebter Jünger führt er uns zur besonderen Verbundenheit mit Jesus, als Zeuge der erlösenden Liebe Gottes zum Glauben, als Theologe zur Kontemplation des ewigen Wortes.
Johannes war der erste, der unter dem Kreuz Maria als Mutter empfangen durfte. Maria und die hl. Eucharistie sind die Quellen seiner innigen Nächstenliebe. In der Einheit von Nächstenliebe und Kontemplation wurzelt das Geheimnis seiner Heiligkeit. Diese Gnade ist der ganzen Kirche als kostbares Erbe geschenkt.
Die Brüder und Schwestern der Gemeinschaft möchten in der Nachfolge Jesu Johannes als ihren Vater annehmen. Sie leben von den Schätzen, die, er uns durch seine Schriften eröffnet hat. Der Apostel fordert uns auf, in Gott zu bleiben, der das Licht und die Liebe ist, damit unsere Freude vollkommen werde.
Der Geist der Gemeinschaft
 Die Weihe an die Hl. Dreifaltigkeit kann nur wirklich gelebt werden durch das Opfer Christi, des Hohenpriesters, der sich als Ganzopfer der Liebe des Vaters hingibt. Jedes Mitglied der Gemeinschaft will deshalb aus dem Priestertum Christi leben. Dieses kostbarste Geschenk seines Priestertums, das Christus seiner Kirche hinterlassen hat, wird ergänzt (nach Kol 1, 24) durch das königliche Priestertum der Gläubigen und das Amtspriestertum. Daher möchten alle, wie der hl. Johannes und mit ihm, in einem Leben nach dem Evangelium Jesus folgen bis zum Kreuz, wo der geliebte Sohn des Vaters sein priesterliches Werk vollendet. Aus diesem kontemplativen Priestertum leben heißt, zuerst alles im inneren Gebets von Gott zu empfangen. So können sie diese Liebe dann denen weitergeben, die danach dürsten. Dadurch verherrlichen sie den Vater und helfen den Menschen von heute, die Anbetung und die brüderliche Liebe wiederzuentdecken.
Die Weihe an die Hl. Dreifaltigkeit kann nur wirklich gelebt werden durch das Opfer Christi, des Hohenpriesters, der sich als Ganzopfer der Liebe des Vaters hingibt. Jedes Mitglied der Gemeinschaft will deshalb aus dem Priestertum Christi leben. Dieses kostbarste Geschenk seines Priestertums, das Christus seiner Kirche hinterlassen hat, wird ergänzt (nach Kol 1, 24) durch das königliche Priestertum der Gläubigen und das Amtspriestertum. Daher möchten alle, wie der hl. Johannes und mit ihm, in einem Leben nach dem Evangelium Jesus folgen bis zum Kreuz, wo der geliebte Sohn des Vaters sein priesterliches Werk vollendet. Aus diesem kontemplativen Priestertum leben heißt, zuerst alles im inneren Gebets von Gott zu empfangen. So können sie diese Liebe dann denen weitergeben, die danach dürsten. Dadurch verherrlichen sie den Vater und helfen den Menschen von heute, die Anbetung und die brüderliche Liebe wiederzuentdecken.
Jesus bittet den Vater für seine Apostel: „Heilige sie in der Wahrheit; dein Wort ist Wahrheit“ (Joh 17, 17). In diesem Licht wollen die Brüder ihre Hingabe leben und brauchen deswegen eine fundierte intellektuelle Ausbildung. Wie Johannes möchten sie ihren Verstand in den Dienst der Liebe stellen und als treue Zeugen der Kirche dienen. Diese demütige Suche nach der Wahrheit reinigt den Intellekt und die Phantasie und trägt zur Reinigung des Herzens bei, die der Hl. Geist und Maria bewirken. Diese Reinigung ist notwendig, damit die Liebe frei wird und damit Jesus sie immer mehr an sich ziehen kann. „Wer die Wahrheit tut, kommt zum Licht“ (Joh 3, 21).
Das Zweite Vatikanische Konzil wünschte eine Öffnung zur Welt hin. Daher umfasst die Ausbildung ein Philosophiestudium, um den Menschen, seine Finalität und seine Sehnsüchte besser zu verstehen. Die großen aktuellen Probleme, die sich dem Christen heute stellen, werden betrachtet. In unserer Welt gibt es viele Ideologien, oft atheistische, die das Abbild Gottes im Menschen entstellen und ihn hindern, seinen Intellekt in den Dienst der Liebe zu stellen. Die philosophischen Studien stehen ihrerseits im Dienst der theologischen Ausbildung; und die theologische Forschung stützt sich auf die Kenntnis des Wortes Gottes gemäß der kirchlichen Überlieferung der Kirchenväter und des hl. Thomas von Aquin. In dieser Weise soll das Geheimnis unseres Erlösers Jesus Christus in seiner Fülle und Aktualität vermittelt werden. Jedes Mitglied der Gemeinschaft will der Verpflichtung der Kirche nachkommen, das Erbe des Glaubens verständlich und überzeugend an die Menschen unserer Zeit weiterzugeben (vgl. Evangelii Nuntiandi, 3).
In diesem Sinne hat die Gemeinschaft die Johannesschule gegründet, deren Studiengang neben den Brüdern und Schwestern auch allen offen steht, die sich dafür interessieren. Hier soll die Weisheit in ihren drei Bereichen – Philosophie, Theologie und Mystik – unablässig vertieft werden.
Die drei Bünde
 Der Bund mit Jesus in der Eucharistie, Quelle der Einheit zwischen stiller Anbetung und liturgischem Stundengebet. Diese Liturgie ist einerseits der monastischen Liturgie sehr ähnlich, andererseits ist sie vereinfacht, damit sie den Anforderungen des apostolischen Lebens gerecht wird und damit mehr Zeit für das gemeinsame stille Gebet bleibt.
Der Bund mit Jesus in der Eucharistie, Quelle der Einheit zwischen stiller Anbetung und liturgischem Stundengebet. Diese Liturgie ist einerseits der monastischen Liturgie sehr ähnlich, andererseits ist sie vereinfacht, damit sie den Anforderungen des apostolischen Lebens gerecht wird und damit mehr Zeit für das gemeinsame stille Gebet bleibt.- Der Bund mit Maria, Mutter und Hüterin des Wachstums im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe und somit göttliches „Milieu“ des kontemplativen Lebens. In diesem Bund mit Maria – da nahm sie der Jünger zu sich (Joh 19, 27) – gründet die Einheit der brüderlichen Liebe im gemeinsamen Leben.
- Der Bund mit Petrus, in einem kindlichen Gehorsam gegenüber dem Heiligen Vater, Nachfolger des hl. Petrus, und den Bischöfen. So können wir treu und tief aus der lebendigen Tradition der Kirche leben.